
„Eine prophetische Stimme für unsere Zeit"
Bischof Robert Barron erhält den Josef-Pieper-Preis
Im Rahmen eines feierlichen Symposions am 26./27.7.2025 mit ca. 200 Teilnehmern nahm Bischof Robert Barron in Münster den Josef-Pieper-Preis entgegen. Die Stiftung würdigte damit einen der bedeutendsten katholischen Theologen und Kommunikatoren unserer Zeit, der mit seiner Verkündigung über das Internet und die sozialen Medien ein weltweites Millionenpublikum erreicht.
Die „Wege der Glaubensverkündigung“ standen daher im Mittelpunkt des umfangreichen Vortragsprogramms am Samstag, 26.7., im Franz-Hitze-Haus. Ausgehend vom Grundanliegen Josef Piepers und seiner Sorge um die Bewahrung, den Vollzug und die lebendige Weitergabe des Glaubens spannte sich der thematische Bogen über die Kontexte und Themen, welche die Glaubensverkündigung in Deutschland im 20. Jahrhundert bestimmt haben, bis hin zu den Impulsen für eine zeitgemäße Verkündigung des Wortes Gottes in der Gegenwart, die sich bewußt der modernen Medien bedient.
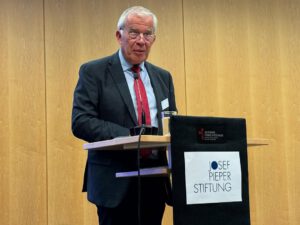 Unter dem Titel „Man muß doch sich zu Wort melden!“ stellte Prof. Dr. Berthold Wald (Paderborn), Vorstandsmitglied der Stiftung, den soeben erschienenen und von ihm herausgegebenen Briefwechsel zwischen Pieper und dem fast gleichaltrigen Schweizer Theologen Hans Urs von Balthasar vor, der einen Zeitraum von fast fünfzig Jahren umfaßt. Viele der Themen, die beide in ihrem Austausch beschäftigten, sind auch heute noch von unverminderter Aktualität. Den Kern der nachkonziliaren Diskussionen um die „Schwierigkeit, heute zu glauben“, erkannten Pieper und von Balthasar im Phänomen der „Entsakralisierung“ und dem damit verbundenen Verständnis von Priestertum und Sakrament. Aus diesem Kontext stammt auch der im Titel-Zitat genannte Impuls.
Unter dem Titel „Man muß doch sich zu Wort melden!“ stellte Prof. Dr. Berthold Wald (Paderborn), Vorstandsmitglied der Stiftung, den soeben erschienenen und von ihm herausgegebenen Briefwechsel zwischen Pieper und dem fast gleichaltrigen Schweizer Theologen Hans Urs von Balthasar vor, der einen Zeitraum von fast fünfzig Jahren umfaßt. Viele der Themen, die beide in ihrem Austausch beschäftigten, sind auch heute noch von unverminderter Aktualität. Den Kern der nachkonziliaren Diskussionen um die „Schwierigkeit, heute zu glauben“, erkannten Pieper und von Balthasar im Phänomen der „Entsakralisierung“ und dem damit verbundenen Verständnis von Priestertum und Sakrament. Aus diesem Kontext stammt auch der im Titel-Zitat genannte Impuls.
 Den Blick auf den größeren zeitgeschichtlichen Kontext, in dem Piepers Bemühen um Glaubensverkündigung stand – vom Trauma des Ersten Weltkriegs über den katholischen Frühling der 1920er Jahre mit liturgischer Bewegung, akademischen Aufbrüchen und Thomas-Renaissance –, lenkte der Vortrag von Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz (Heiligenkreuz). Im Rahmen der deutschsprachigen Philosophie stellte Josef Pieper „eine Ausnahmeerscheinung“ dar: „Als Zeitgenosse fast des ganzen 20. Jahrhunderts gehört er weder dem Neukantianismus noch der Phänomenologie, weder dem Neuthomismus […] noch der Existenzphilosophie an, sondern ausgehend von soziologischen Überlegungen entwickelte er eine ‚Philosophische Anthropologie‘“. Von wesentlichem Einfluß auf das Denken Piepers waren mehrfach zentrale Gedanken Romano Guardinis. Von der Einsicht in die Wirklichkeitsgemäßheit des Guten über die Tugenden führten die Themen Piepers nach den Zweiten Weltkrieg zur Auseinandersetzung mit dem Verlust des Heiligen und zum kritischen Gespräch mit Joseph Ratzinger, dessen Fernwirkung sich schließlich in der Enzyklika „Deus caritas est“ zeigt, die – deutlich sichtbar – Piepersche Überlegungen aufgreift.
Den Blick auf den größeren zeitgeschichtlichen Kontext, in dem Piepers Bemühen um Glaubensverkündigung stand – vom Trauma des Ersten Weltkriegs über den katholischen Frühling der 1920er Jahre mit liturgischer Bewegung, akademischen Aufbrüchen und Thomas-Renaissance –, lenkte der Vortrag von Prof. Dr. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz (Heiligenkreuz). Im Rahmen der deutschsprachigen Philosophie stellte Josef Pieper „eine Ausnahmeerscheinung“ dar: „Als Zeitgenosse fast des ganzen 20. Jahrhunderts gehört er weder dem Neukantianismus noch der Phänomenologie, weder dem Neuthomismus […] noch der Existenzphilosophie an, sondern ausgehend von soziologischen Überlegungen entwickelte er eine ‚Philosophische Anthropologie‘“. Von wesentlichem Einfluß auf das Denken Piepers waren mehrfach zentrale Gedanken Romano Guardinis. Von der Einsicht in die Wirklichkeitsgemäßheit des Guten über die Tugenden führten die Themen Piepers nach den Zweiten Weltkrieg zur Auseinandersetzung mit dem Verlust des Heiligen und zum kritischen Gespräch mit Joseph Ratzinger, dessen Fernwirkung sich schließlich in der Enzyklika „Deus caritas est“ zeigt, die – deutlich sichtbar – Piepersche Überlegungen aufgreift.
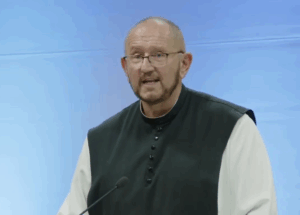 Mit Blick auf die Glaubensverkündigung in der Gegenwart unterstrich der Nationaldirektor von missio Österreich, P. Prof. Dr. Karl Wallner OCist (Wien), die Notwendigkeit und Dringlichkeit „heiliger Inszenierung“ – verstanden „als sinnliche Vermittlung des christlichen Heilsmysteriums“, denn es gehöre „zur Mission der Kirche, in rechter Weise zu ‚inszenieren‘“. Die Gründe dafür sind gleichermaßen anthropologischer wie christologischer Natur: sie liegen in der leib-seelischen, geistig-sinnlichen Doppelnatur des Menschen wie in der Fleischwerdung des göttlichen Wortes. Auf dieser Grundlage formulierte Wallner sieben Impulse zur Medienarbeit als „heiliger Inszenierung“ – wobei er den „Medienthomismus“ oder „Influencerthomismus“ Bischof Barrons ausdrücklich hervorhob: Sein Erfolg liege „auch darin begründet, dass er den dogmatischen Inhalt des Glaubens klar und nüchtern expliziert. […] Junge Menschen sind auch deshalb fasziniert, weil sie hier argumentativ wohlproportioniert aufbereitet bekommen, was sie als intellektuelle Glaubensnahrung brauchen. Bischof Barron gibt nicht das Fast-Food der kurzen Emotionalisierung, sondern das Long-Food des reflektierten Glaubens.“
Mit Blick auf die Glaubensverkündigung in der Gegenwart unterstrich der Nationaldirektor von missio Österreich, P. Prof. Dr. Karl Wallner OCist (Wien), die Notwendigkeit und Dringlichkeit „heiliger Inszenierung“ – verstanden „als sinnliche Vermittlung des christlichen Heilsmysteriums“, denn es gehöre „zur Mission der Kirche, in rechter Weise zu ‚inszenieren‘“. Die Gründe dafür sind gleichermaßen anthropologischer wie christologischer Natur: sie liegen in der leib-seelischen, geistig-sinnlichen Doppelnatur des Menschen wie in der Fleischwerdung des göttlichen Wortes. Auf dieser Grundlage formulierte Wallner sieben Impulse zur Medienarbeit als „heiliger Inszenierung“ – wobei er den „Medienthomismus“ oder „Influencerthomismus“ Bischof Barrons ausdrücklich hervorhob: Sein Erfolg liege „auch darin begründet, dass er den dogmatischen Inhalt des Glaubens klar und nüchtern expliziert. […] Junge Menschen sind auch deshalb fasziniert, weil sie hier argumentativ wohlproportioniert aufbereitet bekommen, was sie als intellektuelle Glaubensnahrung brauchen. Bischof Barron gibt nicht das Fast-Food der kurzen Emotionalisierung, sondern das Long-Food des reflektierten Glaubens.“
 Den Preisträger näher vorzustellen, seine besondere Nähe und Übereinstimmung mit Josef Pieper und seinem Denken zu zeigen und schließlich nach seinen Ideen für die zukünftige Verkündigungstätigkeit in Deutschland zu fragen, waren die Leitlinien des abendlichen Podiumsgesprächs, das Prof. Dr. Ludger Schwienhorst-Schönberger (Wien) und Prof. Dr. Berthold Wald mit Bischof Dr. Robert Barron führten. Von der Frage nach der persönlichen Entdeckung seines „Helden“ Thomas von Aquin über die Bedeutung der Philosophie für den christlichen Glauben, die Rolle des Wahren, Guten und vor allem Schönen für die Erschließung des Glaubens spannte sich der Bogen zur Verhältnisbestimmung von Christentum und säkularer Kultur und von Religion und Politik – wobei auch aktuelle Fragestellungen zur Sprache kamen. Mit dem II. Vatikanische Konzil betonte Barron die „relative Autonomie der irdischen Wirklichkeiten“. Einen besonderen Akzent setzten die Ausführungen des Bischofs von Winona-Rochester zum persönlichen Gebet und sein Rat zur Praxis einer „heiligen Stunde“ (holy hour) als Quelle und Ursprung allen missionarischen Wirkens.
Den Preisträger näher vorzustellen, seine besondere Nähe und Übereinstimmung mit Josef Pieper und seinem Denken zu zeigen und schließlich nach seinen Ideen für die zukünftige Verkündigungstätigkeit in Deutschland zu fragen, waren die Leitlinien des abendlichen Podiumsgesprächs, das Prof. Dr. Ludger Schwienhorst-Schönberger (Wien) und Prof. Dr. Berthold Wald mit Bischof Dr. Robert Barron führten. Von der Frage nach der persönlichen Entdeckung seines „Helden“ Thomas von Aquin über die Bedeutung der Philosophie für den christlichen Glauben, die Rolle des Wahren, Guten und vor allem Schönen für die Erschließung des Glaubens spannte sich der Bogen zur Verhältnisbestimmung von Christentum und säkularer Kultur und von Religion und Politik – wobei auch aktuelle Fragestellungen zur Sprache kamen. Mit dem II. Vatikanische Konzil betonte Barron die „relative Autonomie der irdischen Wirklichkeiten“. Einen besonderen Akzent setzten die Ausführungen des Bischofs von Winona-Rochester zum persönlichen Gebet und sein Rat zur Praxis einer „heiligen Stunde“ (holy hour) als Quelle und Ursprung allen missionarischen Wirkens.
 Im Anschluß an ein feierliches Pontifikalamt am Sonntag, 27.7.2025, in der Überwasserkirche, in der 1997 das Requiem für Josef Pieper stattgefunden hatte, würdigte Bischof Dr. Stefan Oster (Passau) im Rahmen seiner Laudatio beim Festakt im Priesterseminar Borromaeum Josef Pieper und Robert Barron gleichermaßen als Menschen, die die Fähigkeit haben, andere Menschen zu entzünden – aus dem Wissen um die menschliche Person, ihre Natürlichkeit wie ihre Liebes- und Erlösungsbedürftigkeit, aber auch aus der persönlichen Erfahrung des Gebets und der Gottesbegegnung. Eine umfassende biblische Bildung, die philosophische Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Konzepten vom Menschen, die Evangelisierung durch Schönheit kennzeichnete Oster als besondere Facetten der Verkündigung Barrons, um dem „gepufferten Selbst“ (buffered self, Charles Taylor) der Gegenwartskultur zu begegnen und einem „beige catholicism“, bei dem „die herrschende Kultur den Glauben dominiert“ und dem es in erster Linie um politische Diffamierung und populistische Instrumentalisierung geht, darum „einen substanziell und intellektuell tief dargelegten Katholizismus schnell mal als ‚rechts‘ zu diffamieren.“ Oster erinnerte demgegenüber an ein zentrales Prinzip der Verkündigung Barrons: „Don’t dumb down the faith“. Deshalb hoffe er, „dass auch diese Preisverleihung heute noch viel mehr suchende Menschen auf ihn aufmerksam macht – und dass er auf diese Weise auch in unserem Land mit beitragen kann zu einem neuen Aufbruch des katholischen Glaubens – wie in seiner eigenen Heimat.“
Im Anschluß an ein feierliches Pontifikalamt am Sonntag, 27.7.2025, in der Überwasserkirche, in der 1997 das Requiem für Josef Pieper stattgefunden hatte, würdigte Bischof Dr. Stefan Oster (Passau) im Rahmen seiner Laudatio beim Festakt im Priesterseminar Borromaeum Josef Pieper und Robert Barron gleichermaßen als Menschen, die die Fähigkeit haben, andere Menschen zu entzünden – aus dem Wissen um die menschliche Person, ihre Natürlichkeit wie ihre Liebes- und Erlösungsbedürftigkeit, aber auch aus der persönlichen Erfahrung des Gebets und der Gottesbegegnung. Eine umfassende biblische Bildung, die philosophische Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Konzepten vom Menschen, die Evangelisierung durch Schönheit kennzeichnete Oster als besondere Facetten der Verkündigung Barrons, um dem „gepufferten Selbst“ (buffered self, Charles Taylor) der Gegenwartskultur zu begegnen und einem „beige catholicism“, bei dem „die herrschende Kultur den Glauben dominiert“ und dem es in erster Linie um politische Diffamierung und populistische Instrumentalisierung geht, darum „einen substanziell und intellektuell tief dargelegten Katholizismus schnell mal als ‚rechts‘ zu diffamieren.“ Oster erinnerte demgegenüber an ein zentrales Prinzip der Verkündigung Barrons: „Don’t dumb down the faith“. Deshalb hoffe er, „dass auch diese Preisverleihung heute noch viel mehr suchende Menschen auf ihn aufmerksam macht – und dass er auf diese Weise auch in unserem Land mit beitragen kann zu einem neuen Aufbruch des katholischen Glaubens – wie in seiner eigenen Heimat.“
 In seiner Dankesrede gab Bischof Dr. Robert Barron seiner Überzeugung Ausdruck, daß „das Denken Josef Piepers von besonderer Bedeutung für unsere Zeit“ sei. Als Kennzeichen der besonderen und unverwechselbaren Geisteshaltung Piepers arbeitete er den Sinn des philosophischen Akts heraus, der gegenüber der gewöhnlichen Erfahrung offen ist, „in Beziehung zu treten zum Allgesamt des Seienden“, sich erschüttern zu lassen und eine empfangende Haltung der Kontemplation einzunehmen. Auf seiner Grundlage werde die Hinordnung menschlicher Erkenntnis auf Gott wahrnehmbar, der letzter Grund aller Wahrheit und Erkennbarkeit der Dinge ist. Von ihm aus besitzen die Dinge gleichermaßen ihre Erkennbarkeit wie Unerkennbarkeit, und dem menschlichen Erkenntnisbemühen wohnt bleibend eine innere „Hoffnungsstruktur“ inne. Ihren Schlußpunkt findet die philosophische Haltung Piepers daher schließlich in seinem Konzept von „Muße und Kult“: „Die Kultur lebt aus dem Kult. Und auf dieses innere Ursprungsverhältnis muß zurückgegriffen werden, wenn sie als Ganzes in Frage gestellt wird.“ Den entscheidenden Akzent des Beitrags Piepers für unsere heutige Kultur sieht Barron folglich darin, den Sinn für Kult und „Festlichkeit zurückzugewinnen, aber eben in einem religiösen Kontext“: „Neben Übungen, die den philosophischen Akt und ein korrekteres Verständnis des Wesens Gottes fördern, ist es daher vielleicht das Wichtigste, dass wir den Mantel der hebräischen Propheten zurückfordern und unser Volk zum rechten Lobpreis und weg von den falschen Göttern rufen“. – In diesem Anliegen aber wird Josef Pieper in besonderer Weise vernehmbar als „eine prophetische Stimme für unsere Zeit“.
In seiner Dankesrede gab Bischof Dr. Robert Barron seiner Überzeugung Ausdruck, daß „das Denken Josef Piepers von besonderer Bedeutung für unsere Zeit“ sei. Als Kennzeichen der besonderen und unverwechselbaren Geisteshaltung Piepers arbeitete er den Sinn des philosophischen Akts heraus, der gegenüber der gewöhnlichen Erfahrung offen ist, „in Beziehung zu treten zum Allgesamt des Seienden“, sich erschüttern zu lassen und eine empfangende Haltung der Kontemplation einzunehmen. Auf seiner Grundlage werde die Hinordnung menschlicher Erkenntnis auf Gott wahrnehmbar, der letzter Grund aller Wahrheit und Erkennbarkeit der Dinge ist. Von ihm aus besitzen die Dinge gleichermaßen ihre Erkennbarkeit wie Unerkennbarkeit, und dem menschlichen Erkenntnisbemühen wohnt bleibend eine innere „Hoffnungsstruktur“ inne. Ihren Schlußpunkt findet die philosophische Haltung Piepers daher schließlich in seinem Konzept von „Muße und Kult“: „Die Kultur lebt aus dem Kult. Und auf dieses innere Ursprungsverhältnis muß zurückgegriffen werden, wenn sie als Ganzes in Frage gestellt wird.“ Den entscheidenden Akzent des Beitrags Piepers für unsere heutige Kultur sieht Barron folglich darin, den Sinn für Kult und „Festlichkeit zurückzugewinnen, aber eben in einem religiösen Kontext“: „Neben Übungen, die den philosophischen Akt und ein korrekteres Verständnis des Wesens Gottes fördern, ist es daher vielleicht das Wichtigste, dass wir den Mantel der hebräischen Propheten zurückfordern und unser Volk zum rechten Lobpreis und weg von den falschen Göttern rufen“. – In diesem Anliegen aber wird Josef Pieper in besonderer Weise vernehmbar als „eine prophetische Stimme für unsere Zeit“.

